- -15%



Aussaat März bis Juli. Wenn Karotten mit einem Abstand von ca. 15-25 tagen gesät werden, verlängert sich die Erntezeit. Boden sollte nicht zu hart sondern leicht, durchlässig und Nährstoffreich sein. Düngen lieber mit Kompost, Misst währe bei Karotten eher ungünstig. Da Karotten einen hohen Kalibedarf haben ist eine verdünnte Beinwelljauche als Zwischendünger gut geeignet.
Staunässe ist auch zu vermeiden. An der gleichen Stelle können Karotten 4-5 Jahre wachsen, gute Vorkulturen sind solche, die im Jahr zuvor viel Düngung erhalten haben, wie z.B. Kohl, Kürbisse, Gurken. Normaleweise werden Tomaten auch als eine gut gedüngte Vorkultur vorgeschlagen, da sie bei uns aber eher gemäßigt gedüngt werden, geben wir nicht dieser Empfehlung.
Technische Daten
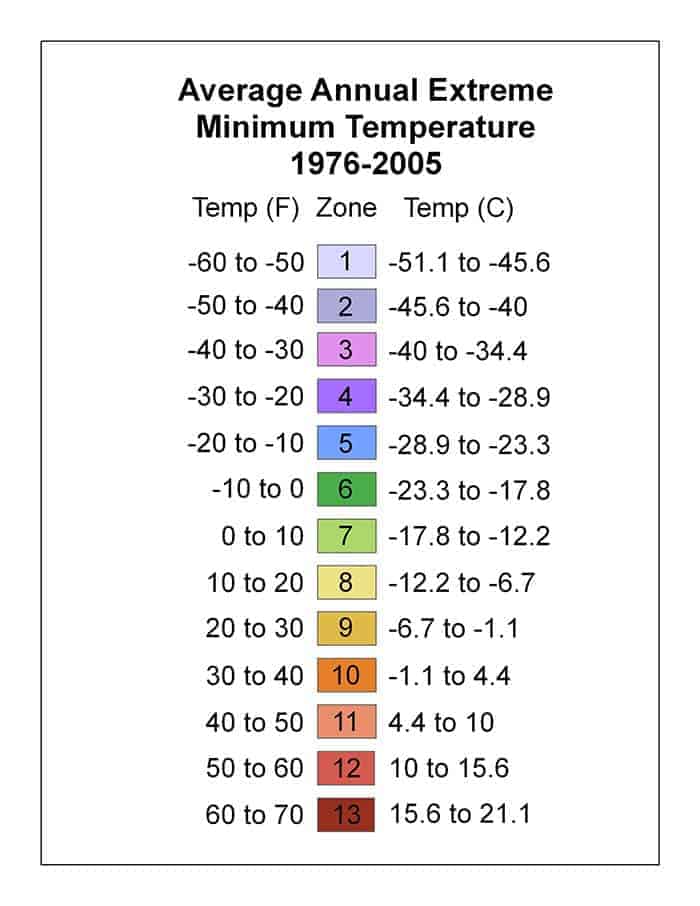
 Bewertungen (0)
Bewertungen (0)